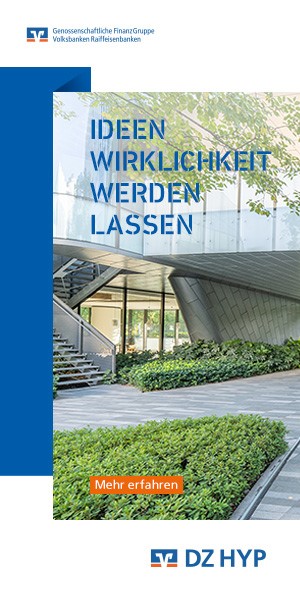Finanzierung: Im Immobiliengeschäft vollzieht sich ein Wandel. Künftig wird es mehr um Modernisierungen und energetische Renovierungen als um Neubaufinanzierungen gehen.
Anzeige
Anzeige
Frau Professorin Krön, Bundesbauministerin Verena Hubertz will mit dem „Wohnungsbau-Turbo“ schnelleres und einfacheres Bauen ermöglichen. Wie bewerten Sie die Erfolgsaussichten? Bisher sind alle politischen Initiativen, den Wohnungsbau anzukurbeln, krachend gescheitert.

Elisabeth Krön ist Professorin und wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Bau und Immobilie (IBI) an der Technischen Hochschule Augsburg. Foto: Ilona Stelzl/THA
Elisabeth Krön: Als „krachend gescheitert“ würde ich die verschiedenen Initiativen der vergangenen Jahre nicht bezeichnen. Ursache für die unerfüllten Neubauquoten waren nicht einfach falsche Ziele oder Maßnahmen, sondern es gab in dieser Zeit mit der Corona-Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine unvorhersehbare Einflüsse, die jede Planung außer Kraft gesetzt haben. Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise und in der Folge auch die Materialpreise von Baustoffen in die Höhe getrieben. Zement und Stahl, aber auch Dämmmaterialien und Glas sind in der Herstellung extrem energieintensiv, hohe Energiepreise schlagen daher unmittelbar auf die Materialpreise durch. All dies war verknüpft mit einem Arbeitskräftemangel, der sich immer mehr zugespitzt hat. Der aktuelle Wohnungsbau-Turbo von Ministerin Hubertz fokussiert nun auf Erleichterungen im Bereich der Bebauungspläne. Das ist sicherlich eine wichtige Stellgröße, um Bauvorhaben zu beschleunigen, denn gerade auch die Genehmigungsprozesse verschlingen zu viel Zeit – und die kostet Geld. Eine Aufstellung von Bebauungsplänen dauert gerne mal zwei Jahre, danach schlägt die Baugenehmigung nochmal mit bis zu einem Jahr zu Buche. An dieser Stelle anzusetzen, halte ich für einen guten Punkt.
Der Baupreisindex für Wohngebäude ist laut Statistischem Bundesamt im Zeitraum 2010 bis 2022 um 64 Prozent gestiegen. Die Inflationsrate stieg im gleichen Zeitraum nur um 25 Prozent. Warum ist das Bauen so teuer geworden?
Krön: Ich führe das im Wesentlichen auf zwei Entwicklungen zurück. Ein Faktor sind die Baupreise, die wegen der stark gestiegenen Energiepreise in die Höhe geschnellt sind. Das hat die gesamte Branche kalt erwischt, nicht zuletzt den Wohnungsbau. Glücklicherweise haben sich die Energiemärkte mittlerweile etwas beruhigt, deshalb sehen wir aktuell auch keine weiteren Preissprünge. Daneben sind es die gestiegenen Zinsen, die so manches Projekt ausgebremst haben. Baupreise wie Zinsen lassen Bauträger wie Projektentwickler, aber auch private Bauherren, zögern, bereits geplante Vorhaben umzusetzen. Dadurch verstärken sie die Mangelsituation und treiben die Preise weiter nach oben. Immerhin haben wir es aktuell zwar nicht mit fallenden, aber zumindest mit planbareren Baukosten zu tun. Das ist ein Bremsfaktor weniger, der hoffentlich wieder zu mehr Bautätigkeit führt.
„Wenn die Grundstückspreise sinken und sich die Märkte beruhigen, wäre das positiv.“
Was muss neben planbaren Baukosten und schnelleren Genehmigungsverfahren sonst noch geschehen, damit in Deutschland und insbesondere in Bayern tatsächlich mehr und vor allem bezahlbare Wohnungen gebaut werden?
Krön: In erster Linie ist und bleibt es eine Kostenfrage. Neben den Baupreisen spielen auch die Grundstückspreise eine große Rolle. Besonders in den Ballungsräumen bewegen sich diese in schmerzhaften Höhen und treiben die Quadratmeterpreise für Wohnflächen nach oben. Wenn die Grundstückspreise sinken und sich die Märkte beruhigen, wäre das positiv. Das würde auch die Mieter entlasten, denn die hohen Mieten sind auch Folge der hohen Bau- und Grundstückspreise, die irgendwie refinanziert werden müssen.
Sinkende Grundstückspreise wären sicher hilfreich, aber ist das realistisch?
Krön: Hier kommt es auch auf den Willen zur Zusammenarbeit an. Eine Kommune kann zum Beispiel zu einem Runden Tisch einladen, an dem alle Projektpartner zusammenkommen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Kommunen können Bauland ausweisen, aber auch Gewerbeflächen in Wohnflächen umwidmen. Bauträger und Projektentwickler können sich im Gegenzug und im Zusammenspiel mit dem zu erzielenden Baurecht verpflichten, auf eigene Kosten Infrastruktur für die Allgemeinheit herzustellen. Aber auch die Zusammenarbeit zwischen Ballungsräumen und dem ländlichen Raum ist wichtig. Wie muss die öffentliche Infrastruktur geplant werden, damit die Menschen auch ohne Auto die Möglichkeit haben, ihren Lebensalltag zu gestalten? Hier geht es zum Beispiel um die Erreichbarkeit von Kindergärten, Schulen, Universitäten, Ärzten oder Supermärkten. Wenn die öffentliche Infrastruktur im ländlichen Raum gut ist, sehen sich weniger Menschen gezwungen, in Ballungsräume zu ziehen. Das würde dort den Druck verringern.

Blick auf die Altstadt von Berching am Main-Donau-Kanal: Die Zusammenarbeit zwischen Ballungsräumen und dem ländlichen Raum ist ein wichtiger Faktor, um die Wohnungsnot zu lindern. Foto: mauritius images / Andreas Werth
Eine Möglichkeit, um die Baukosten zu senken, ist serielles Bauen. Welches Potenzial sehen Sie hier, den Wohnungsbau anzukurbeln?
Krön: Für den Wohnungsneubau und teilweise für Sanierungen und Aufstockungen sehe ich hier durchaus Potenzial. Zum einen wirken eine Standardisierung und geringere Individualisierungsmöglichkeiten von Grundrissen und Gebäudeformen generell dämpfend auf die Baukosten. Zum anderen bedeutet serielles Bauen auch, dass viele Bauteile vorgefertigt und auf der Baustelle nur noch montiert werden, vergleichbar mit einem Fertighaus. Serielles Bauen heißt also, schneller zu bauen. Die Geschwindigkeit des Gesamtprozesses ist beim Bauen ein wesentlicher Kostenfaktor. Die Zeit für Planung, Genehmigung und Bau zu schrumpfen, ist das Gebot der Stunde. Die Zeit arbeitet im Grunde gegen das Projekt. Woher soll ein Bauherr wissen, was Stahl und Zement kosten, wenn er die Preise jetzt kalkulieren muss, aber erst in drei Jahren bauen kann? Von daher trägt serielles Bauen sicher dazu bei, die Baukosten besser im Griff zu behalten.
Wie stellt sich die Situation bei gewerblichen Bauten dar? Gibt es dort einen vergleichbaren Engpass wie beim Wohnungsbau?
Krön: Dort ist es tatsächlich anders. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation und weil viele Unternehmen großzügige Regeln für Homeoffice haben, ist die Nachfrage nach Büroflächen sowie Gewerbe- und Logistikflächen rückläufig. Unternehmen versuchen im Gegenteil , ihre Flächenbedarfe zu reduzieren, um Kosten zu sparen. Gerade der Leerstand an Büroflächen ist in den größeren Städten Bayerns angestiegen (Anm. d. Red.: Siehe dazu auch den Beitrag zu den Immobilienmärkten Bayern 2025 in dieser Ausgabe). Wir sehen hier also eine gegenläufige Entwicklung zum Wohnungsmarkt, die einen fast naturgemäß auf die Frage bringt: Warum werden eigentlich Büroflächen nicht in Wohnungen umgewandelt?

Leerstehendes Großraumbüro: Die Umnutzung von Büroflächen in Wohnungen ist ein bestechender Gedanke, aber nicht so einfach umzusetzen. Foto: mauritius images / Rüdiger Rebmann
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Krön: Das ist ein guter Gedanke, der allerdings nicht immer leicht umzusetzen ist. Eine Umwidmung von Gewerbeflächen in Wohnflächen setzt in der Regel eine langwierige Änderung des Bebauungsplans voraus, denn dieser gibt die Nutzungsart vor. Hier könnte man auf politischer Ebene über eine Flexibilisierung der Vorgaben nachdenken. Auf der anderen Seite haben Bürogebäude beispielsweise andere Raumhöhen als Wohngebäude sowie andere Abstände zwischen Treppenhäusern. Eine Umwandlung ist also nicht mit der gleichen Flächeneffizienz zu bewerkstelligen, wie wenn man gleich für eine vorgesehene Nutzung plant und baut. Dennoch lohnt es sich bei geeigneten Bürogebäuden, die Umnutzung in Wohnungen durchzuspielen und nach Möglichkeit auch umzusetzen.
Viele Kommunen haben Stellplatzsatzungen, die genau vorschreiben, wie viele Stellplätze ein Bauherr pro Wohneinheit realisieren muss. Oft genug gibt es keine andere Möglichkeit, als diese Stellplätze in einer Tiefgarage unterzubringen. Das verursacht zusätzliche Kosten. Wie lässt sich dieses Dilemma auflösen?
Krön: Ja, Stellplätze, insbesondere Tiefgaragenstellplätze, verteuern den Wohnungsbau in einem spürbaren Ausmaß, sodass die Reduzierung des Stellplatzschlüssels direkt auf den Wohnungspreis oder die Mietkosten durchschlägt. Viele neuere Stellplatzsatzungen ermöglichen dies bereits. Bei Eigentumswohnungen sind allerdings auch Bauherren teilweise zurückhaltend, weil sie eine andere Erwartung der Käufer vermuten. Ich denke, es gibt hier noch Spielraum – wohlwissend, dass man immer auch die Situation im Quartier im Blick behalten muss. Wenn die Quartiersbewohner Sorge haben, dass die neuen Nachbarn alle auf der Straße parken und der öffentliche Parkraum knapp wird, passt es auch nicht. Man muss also alternative Mobilitätskonzepte parallel mitdenken.

Blick in eine Tiefgarage: Unterirdische Parkplätze verteuern Bauvorhaben in erheblichem Maße. Eine kostengünstigere Alternative sind oberirdische Quartiersgaragen, sofern diese realisierbar sind. Foto: mauritius images / SZ Photo Creative / snapshot/Future Image/C.Hardt
Welche Alternativen sehen Sie?
Krön: Man kann einfachere Baulösungen für Stellplätze finden, also oberirdisch statt unterirdisch bauen. Man kann auch Quartiersgaragen bauen. Für die einzelnen Bewohner bedeutet das, dass sie ein paar Schritte mehr zu ihrem Auto machen müssen, dafür sinken die Kosten. Hier gilt es, die Komforterwartung der Menschen mitzudenken. Abgesehen davon müssen derartige Parkflächen auch wieder im Bebauungsplan ausgewiesen werden.
Welche Herausforderungen bringt der Klimawandel für das Bauen mit sich?
Krön: Erstens geht es weiterhin darum, den Energiebedarf von Gebäuden beim Bau und bei der Nutzung möglichst gering zu halten, um CO2-Emissionen zu vermeiden. So boomt aktuell der Holzbau, denn Holz ist ein natürlicher CO2-Speicher. Wir müssen unsere Gebäude auch weiterhin gut dämmen und sie mit erneuerbaren Energien heizen beziehungsweise kühlen. Auch das reduziert den CO2-Fußabdruck. Außerdem müssen wir dringend die Klimaanpassung angehen. Wir brauchen viel mehr Retentionsflächen, damit das Wasser oberflächennah versickern kann. Dazu müssen wir unsere Dächer begrünen, und zwar idealerweise nicht nur extensiv, sondern intensiv, um das Wasser am schnellen Abfließen zu hindern, damit die Kanalisation nicht überfordert wird. Mehr Grünflächen in den Quartieren wirken sich nicht nur positiv auf das Wassermanagement aus, sondern sie haben auch einen kühlenden Effekt auf das Mikroklima. Das ist besonders wichtig bei Hitzetagen, die wegen des Klimawandels zunehmen. Ich finde es legitim zu diskutieren, wo man Baukosten reduzieren kann. Das darf aber nicht zu Abstrichen beim klimaangepassten Bauen führen, denn das würde uns wegen des fortschreitenden Klimawandels eher früher als später einholen.

Begrünte Dächer in Pforzheim, Baden-Württemberg: Der Bewuchs hindert Regenwasser daran, schnell abzufließen. Das entlastet die Kanalisation und verhindert Überschwemmungen. Foto: mauritius images / Manuel Kamuf / imageBROKER
Dazu eine Detailfrage: Begrünte Dächer müssen nicht nur das Gewicht der Pflanzen, sondern auch des gespeicherten Wassers aushalten. Lässt sich das überhaupt umsetzen, wenn die Statik der Dächer dafür nicht ausgelegt ist?
Krön: Eine berechtigte Detailfrage… Bei Neubauten und bei der Nachrüstung von Bestandsgebäuden lässt sich die Statik von vorneherein so auslegen, dass begrünte Dächer möglich sind. Bei allen anderen Gebäuden ist eine Vorabprüfung der Statik unumgänglich. Aber ich sage mal: Bei Gebäuden mit Stahlbetondecke, die nicht älter als 30 bis 40 Jahre sind, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sich etwas machen lässt.
„Nachhaltig zu bauen kann aber auch bedeuten, Standards zu senken, indem ich zum Beispiel auf Bauteile und Stellplätze verzichte oder so wenig Haustechnik wie möglich in das Gebäude integriere.“
Klimaangepasstes Bauen und Sanieren kostet Geld, die Dämmung eines Gebäudes kann erhebliche Summen verschlingen. Wie kann man nachhaltig bauen, ohne dass es sofort richtig teuer wird?
Krön: Nachhaltig bauen heißt zukunftssicher bauen. So spart das Mitdenken und Minimieren von Überschwemmungsrisiken auf lange Sicht Kosten. Nachhaltig bauen kann aber auch bedeuten, Standards zu senken, indem ich zum Beispiel auf Bauteile und Stellplätze verzichte oder so wenig Haustechnik wie möglich in das Gebäude integriere. Ich kann aber auch den Flächenbedarf an sich reduzieren, indem ich zum Beispiel die Wohnungsgrundrisse anpasse. Das ist ein Trend, der bei Bauträgern schon sichtbar wird. Dann hat eine 80-Quadratmeter-Wohnung vielleicht nicht mehr nur zweieinhalb, sondern wieder dreieinhalb Zimmer. So können wieder mehr Personen diese Wohnung bewohnen. Es gibt also sinnvolle Möglichkeiten, Standards in Bereichen zu reduzieren, die nicht klimarelevant sind. Eine interessante Gesetzesinitiative aus der vergangenen Legislaturperiode ist hierfür der sogenannte Gebäudetyp E für vereinfachtes Bauen. Dieser soll es ermöglichen, von den anerkannten Regeln der Technik abzuweichen, um Kosten zu sparen. Denn diese sorgen zwar für hohe Baustandards, lassen jedoch wenig Spielraum für Vereinfachungen, weil sie in der Rechtsprechung meist als Mindeststandard gewertet werden – unabhängig davon, ob es um bautechnische Erfordernisse oder nur um mehr Wohnkomfort geht. Ich würde der aktuellen Bundesregierung sehr empfehlen, den Gebäudetyp E neben dem Wohnungsbau-Turbo weiterzuverfolgen.
Haben Sie Beispiele, wo Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik möglich sind, um Kosten zu sparen?
Krön: Ein häufig genanntes Beispiel ist der Schallschutz. Hier erlauben wir uns sehr hohe Standards, um die eigene Wohnung vom Lärm der Nachbarn oder von der Straße abzuschirmen. Auch bei der Elektroinstallation sind die Ausstattungsstandards sehr hoch, merkbar unter anderem an den zahlreichen Steckdosen in jedem Zimmer. Generell leisten wir uns teure Gebäudetechnik. Ein drittes Beispiel sind aufwendige mechanische Sonnenschutzsysteme. Das ließe sich konstruktiv manchmal einfacher lösen.
Eine Möglichkeit, effizienter und damit kostensparend zu bauen, wären höhere Gebäude. Das spart auch Flächen.
Krön: Gebäudehöhen werden in Bebauungsplänen definiert, dort passiert sukzessive auch etwas. Auch in den aktualisierten Bauordnungen der Länder sind schon Liberalisierungen bei den Abstandsflächen zu benachbarten Grundstücken und Gebäuden vorgesehen. Diese Abstandsflächen stehen immer in direkter Relation zur Gebäudehöhe. Hier hat beispielsweise die Novelle der Bayerischen Bauordnung, die zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, schon einiges an Erleichterungen gebracht.
„Bei der Digitalisierung gibt es noch Luft nach oben.“
Wie kann die Bauwirtschaft selbst dazu beitragen, dass das Bauen wieder günstiger wird?
Krön: Die Bauwirtschaft hatte Zeiten mit sehr guter Auslastung, wie man sie eigentlich jeder Branche wünscht. Dies hat aber auch dazu geführt, dass die Bauwirtschaft einige Hausaufgaben nicht erledigt hat, weil die Aufträge vorgingen. Um die Produktivität oder Produktivitätszuwächse steht es nicht immer gut, gerade im Vergleich mit anderen Branchen, so ehrlich muss man sein. Produktivitätszuwächse lassen sich auch in der Baubranche realisieren, wenn man will. Im weitesten Sinne geht es um die Industrialisierung der Bauwirtschaft. Also mehr Vorfertigung und Serienbau. Es bedeutet auch, Prozesse zu verschlanken, beginnend mit der Planung und den Vergaben von Bauleistungen. Auch bei der Digitalisierung gibt es Luft nach oben. Ein wichtiges Stichwort ist Building Information Modeling, kurz BIM. Mit BIM wird gemeinschaftlich durch alle Beteiligten eine Art digitaler Zwilling des Gebäudes erstellt, der alle relevanten Daten eines Gebäudes, auch zur Nutzung über den gesamten Lebenszyklus, enthält. Leider kommt Deutschland beim digitalen Bauen weniger schnell voran als die europäischen Nachbarländer. Hier sollten wir uns anstrengen, denn das wirkt sich unmittelbar positiv auf die Produktivität der Bauwirtschaft aus.
Müssen sich nicht auch Behörden und Kommunen den Vorwurf fehlender Digitalisierung gefallen lassen? Man hört doch immer wieder, dass Bauherren zahllose Ordner voller Papier zur Baugenehmigung einreichen müssen.
Krön: Ja, der digitale Bauantrag muss vorankommen, in einigen Städten ist dieser schon eingeführt. Und außerdem geht es um den Grad der Digitalisierung. Es macht einen großen Unterschied, ob man ein PDF per E-Mail verschickt oder ob man zeitgleich an einem digitalen, dreidimensionalen und bearbeitbaren Gebäudemodell arbeitet. Hier haben alle Hausaufgaben zu erledigen, die Genehmigungsbehörden genauso wie die Bauwirtschaft.

Siedlung des Wohnungsvereins München 1899 e.V.: Wenn Bewohner mit unterschiedlichem Platzbedarf Wohnungen tauschen, wird ganz ohne jeden Neubau Wohnraum geschaffen. Foto: mauritius images / SZ Photo Creative / Alessandra Schellnegger
Abschließende Frage: Neubauprojekte mögen den Mangel an Wohnraum lindern, gleichzeitig verbrauchen sie viel Fläche. Wie kann man zusätzlichen Raum für Wohnen und Gewerbe schaffen, ohne dass dafür immer neue Flächen versiegelt werden?
Krön: An dieser Stelle sollten wir auch mehr über soziale Dichte reden. Wir können in den Städten und Gemeinden Bayerns durchaus wieder mehr soziale Dichte vertragen. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen vor 50 Jahren in einer Wohnung gelebt haben und damit im öffentlichen Raum präsent waren, dann waren das viel mehr als heute, weil die Menschen immer mehr Wohnfläche für sich beanspruchen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir die in vielen Häusern ungenutzten Dachgeschosse ausbauen und Gebäude höher bauen, dann kann der öffentliche Raum die zusätzlichen Bewohner locker aufnehmen. Eine höhere soziale Dichte im öffentlichen Raum würde uns an vielen Stellen sogar guttun. Sie würde Straßen und Plätze beleben sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Nachbarschaften stärken. Der Ausbau von Dachgeschossen und höhere Gebäude schaffen zudem Wohnraum, ohne zusätzliches Bauland zu verbrauchen. Auch der Wohnungstausch hilft dabei, die soziale Dichte im Bestand zu erhöhen.
Das müssen Sie erklären…
Krön: Viele Menschen leben in Wohnungen, die eigentlich viel zu groß für sie sind, weil zum Beispiel die Kinder längst ausgezogen sind oder der Partner verstorben ist. Sie sind jedoch nur bedingt bereit, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, weil sie etwa den Umzug scheuen und eine kleinere Wohnung aufgrund des Mietpreisgefüges und der Mietsteigerungen in den vergangenen Jahren selten preiswerter, in vielen Fällen sogar teurer ist. Eigentlich steigt man bei einem neuen Mietvertrag immer mit einer ungünstigeren Quadratmetermiete ein, wenn man nicht unbändiges Glück hat. Deshalb sollten wir den Wohnungstausch fördern, um ungenutzten Wohnraum wieder zugänglich zu machen und zum Beispiel jungen Familien die Chance zu geben, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die richtige Wohnung in der passenden Größe zu finden.
Wie bekommt man Menschen dazu, in eine kleine Wohnung zu ziehen, wenn sie das eigentlich nicht wollen?
Krön: Möglich sind zum Beispiel finanzielle Anreize oder praktische Hilfen, etwa beim Umzug oder bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Akteure, die einen größeren Wohnungsbestand halten, etwa Wohnungsbaugenossenschaften, tun sich da natürlich leichter. Sie können Mietern innerhalb des eigenen Bestands eine alternative Wohnung anbieten, wenn sich deren Wohnraumbedarf reduziert hat. Das gibt dann wiederum zum Beispiel Paaren mit Familienzuwachs die Chance, in eine größere Wohnung zu ziehen. Wenn der Wohnungswechsel jedoch mit einem Vermieterwechsel und vielleicht auch mit einer Verschlechterung beim Mietpreis verbunden ist, dann wird es ohne finanzielle Anreize nicht gehen. Wer dafür aufkommt, steht auf einem anderen Blatt. Was ich damit aber auch sagen will: Man muss nicht immer neu bauen, um Wohnraum zu schaffen, es gibt auch nachhaltigere Modelle. Das wäre auch mein Wunsch an die Politik, solche Modelle zu fördern. Man muss sich nur trauen.
Frau Professor Krön, herzlichen Dank für das Interview!