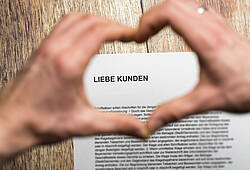Interview: Wie können Unternehmen ihre Kunden begeistern? Mit dieser Frage setzt sich das Marktforschungsunternehmen Kantar intensiv auseinander.
Herr Perst, Herr Dulgeridis, Sie haben in einer wissenschaftlichen Arbeit untersucht, wann Kundinnen und Kunden von Genossenschaftsbanken dazu tendieren, zu Fintechs zu wechseln. Zu welchen Ergebnissen sind Sie zusammenfassend gekommen?
Florian Perst: Die Untersuchung zeigt: Nicht Alter, Einkommen oder Bildungsgrad entscheiden über die Wechselbereitschaft – wie bislang in der Fachliteratur angenommen –, sondern psychologische Faktoren wie emotionale Bindung, persönlicher Beratungswunsch und Vertrauen. Gleichzeitig wirken Anreize wie Gebührenerlass oder eine moderne App als Wechselmotivatoren. Dazu haben wir in einer quantitativen Online-Befragung mit 981 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Hypothesen zu demografischen Merkmalen, emotionaler Bindung, Sicherheitsbedenken, persönlicher Beratung und Gebührenerlass geprüft. Besonders bei den Gebühren war bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung eine erhöhte Wechselbereitschaft erkennbar, weshalb im Praxistransfer für die Volks- und Raiffeisenbanken verschiedene Gebühren- und Produktmodelle in Betracht gezogen werden sollten. FinTechs werden vor allem mit Geschwindigkeit und Komfort verbunden, klassische Banken hingegen mit Nähe und Sicherheit. Wechselbereitschaft entsteht insbesondere dann, wenn bestehende Beziehungen schwächer werden und der digitale Service enttäuscht. Genossenschaftsbanken verfügen weiterhin über starke Bindungsvorteile, müssen diese jedoch aktiv pflegen.
„Besonders offen für einen Wechsel zeigen sich digital affine Kundinnen und Kunden mit wenig persönlichem Kontakt zur Bank.“
Marcel Dulgeridis, Leiter Rechnungswesen bei der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann
Bei welchen Kundengruppen erkennen Sie eine erhöhte Wechselbereitschaft?
Marcel Dulgaridis: Spannend war zunächst die Erkenntnis, dass die initiale Wechselbereitschaft – zumindest im Hinblick auf den Wechsel von einer Bank zu einem FinTech – nicht so hoch war wie erwartet. Besonders offen für einen Wechsel zeigen sich digital affine Kundinnen und Kunden mit wenig persönlichem Kontakt zur Bank. Häufig handelt es sich dabei um jüngere Menschen, die schnelle, günstige und mobile Services erwarten. Wer keinen festen Ansprechpartner hat oder sich nicht mehr emotional angesprochen fühlt, prüft eher Alternativen. Wechselbereitschaft entsteht dabei oft nicht aus Unzufriedenheit, sondern aus der Erwartung, dass es „woanders“ einfacher oder günstiger ist. Entscheidend für den Verbleib sind letztlich Servicequalität und Beziehungsarbeit.
Verhaltensökonomische Analyse
Die im Interview geschilderten Erkenntnisse basieren auf der Masterarbeit „Switching Behavior: Von der Hausbank zu Fintechs – Der Wandel im Kundenverhalten. Eine verhaltensökonomische Analyse der Barrieren und Treiber beim Wechsel zu digitalen Finanzdienstleistern“, eingereicht von Florian Perst an der IU Internationalen Hochschule, Studiengang Digital Transformation Management – Finanzwesen. Betreut wurde die Arbeit von Marcel Dulgeridis, Professor für Betriebswirtschaftslehre der IU Internationalen Hochschule am Standort Regensburg sowie Leiter Rechnungswesen bei der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann.
Welche Strategien beobachten Sie bei Genossenschaftsbanken sowie bei Fintechs, um Neukunden zu gewinnen beziehungsweise Bestandskunden zu halten?
Perst: In der gesamten Retailbranche zeichnet sich ein klarer Wandel ab: weg von einem rein produktzentrierten Denken, hin zu einem ganzheitlich kundenzentrierten Ansatz. Statt ausschließlich die Produkte und deren Merkmale in den Fokus zu stellen, rücken die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Lebenssituationen der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt. Dies bedeutet, dass Dienstleistungen und Angebote stärker personalisiert, erlebbar und bedarfsgerecht gestaltet werden. Nur so kann eine nachhaltige Kundenbindung entstehen, die sich nicht nur an kurzfristigen Verkaufszahlen, sondern an langfristiger Zufriedenheit und Vertrauen orientiert.
Dulgeridis: Die drei stärksten Faktoren der Kundenbindung – Vertrauen, emotionale Nähe und persönliche Betreuung – sind auch zentrale Hebel der Kundengewinnung. Kundinnen und Kunden schätzen Kontinuität, regionale Verbundenheit und vor allem die Beziehung zu einem konkreten Ansprechpartner, der das Gefühl vermittelt, nicht nur als Kunde, sondern als Mensch wahrgenommen zu werden. Wenn auch Fintechs ein solches Werteversprechen gezielt adressieren und authentisch leben, können sie bestehende Barrieren abbauen und die initiale Zurückhaltung gegenüber einem Wechsel überwinden. Das genossenschaftliche Wertesystem, das sich durch gelebte Verlässlichkeit und Werteorientierung auszeichnet, wirkt hier als Vorbild. Im Umkehrschluss heißt das: Es wird in Zukunft für Genossenschaftsbanken nochmal wichtiger, eine wertschätzende Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen, um sie zu halten.

Kundenbindung ist vor allem Beziehungsarbeit – sowohl persönlich als auch im digitalen Bereich. Foto: mauritius images / Westend61 / Uwe Umstätter
Was können Genossenschaftsbanken in der Praxis tun, um die Kundenbindung zu stärken?
Dulgeridis: Kundenbindung ist vor allem Beziehungsarbeit – und genau hier liegt ein strategischer Ansatzpunkt, um nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und die Bleibebereitschaft positiv zu beeinflussen. Vier Handlungsfelder sind zentral:
- Emotionale Bindung durch persönliche Ansprache und Präsenz.
- Vertrauensaufbau – auch digital – durch Transparenz und Sicherheit.
- Beratung neu denken: flexibel, proaktiv, hybrid.
- Frühindikatoren erkennen: Wer droht abzuspringen, muss frühzeitig adressiert werden.
Diese Elemente bilden das Fundament moderner Kundenbindung – ohne die Wurzeln der Genossenschaft aus dem Blick zu verlieren.
Wie lässt sich die emotionale Bindung der Kundinnen und Kunden verbessern?
Perst: Die emotionale Bindung zu Kundinnen und Kunden verbessert sich vor allem durch konsequente Kundenzentriertheit – weg vom reinen Produktfokus hin zum echten „Know Your Customer“-Prinzip. Das bedeutet, die Bedürfnisse, Wünsche und Lebensumstände der Kunden wirklich zu verstehen und aktiv in Entscheidungen einzubeziehen, beispielsweise bei der Gestaltung von Produktkategorien. Diese Einbindung darf keine einmalige Phase sein, sondern muss im Alltag gelebt werden, sodass Kunden merken, dass ihre Meinung zählt. Wichtig ist zudem, die gesamte Customer Journey zu betrachten und den Datenschatz, auf dem alle Banken sitzen, aktiv zu nutzen. Die systematische Auswertung dieser Daten im rechtlich zulässigen Rahmen ermöglicht es, Kundenverhalten und -bedürfnisse besser zu verstehen und individuell zugeschnittene Angebote zu entwickeln. So wird nicht nur Vertrauen geschaffen, sondern auch eine nachhaltige emotionale Bindung gefördert.
„Wichtig sind proaktive Ansprache, klare Sprache und echte Problemlösungen – nicht erst, wenn der Kunde fragt, sondern vorher.“
Marcel Dulgeridis, Leiter Rechnungswesen bei der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann
Wie können die Genossenschaftsbanken ihre Beratung stärken, um sich von den FinTechs abzuheben?
Dulgeridis: Durch echte Nähe, Kompetenz und Flexibilität. Beratung muss mehr sein als Produkterklärung – sie sollte Lebensbegleitung sein. Digitale Kanäle können unterstützen, ersetzen aber nicht den persönlichen Kontakt. Wer Beratung als Erlebnismoment begreift, schafft einen bleibenden Unterschied. Wichtig sind proaktive Ansprache, klare Sprache und echte Problemlösungen – nicht erst, wenn der Kunde fragt, sondern vorher.
Welche Rolle spielt Vertrauen für die Kundenbindung?
Perst: Vertrauen spielt eine zentrale Rolle – oft ist es sogar der entscheidende Grund, warum Kundinnen und Kunden bei einem Unternehmen bleiben, selbst wenn es günstigere Alternativen gibt. Besonders im digitalen Raum muss Vertrauen aktiv aufgebaut und gepflegt werden, etwa durch Sicherheit, Transparenz und Verlässlichkeit. Genossenschaftsbanken haben hier einen natürlichen Vorteil, den sie aber auch sichtbar machen müssen. Wichtig sind dabei Kontinuität, klare Kommunikation und das Gefühl, dass man bei der Genossenschaftsbank gut aufgehoben ist. Die Studie zeigt zudem, dass Transparenz, Empfehlungen und ein guter Support besonders entscheidend sind, um Vertrauen zu stärken und somit die Kundenbindung nachhaltig zu sichern.
Wie können wechselwillige Kundinnen und Kunden frühzeitig identifiziert und im besten Fall von einem Wechsel abgehalten werden?
Perst: Hier sind vor allem die Betreuer gefragt, weil sie Kundinnen und Kunden am besten kennen und Veränderungen frühzeitig bemerken können. Ein klassisches Alarmsignal ist zum Beispiel, wenn Kundinnen und Kunden plötzlich seltener in die Filiale kommen, obwohl sie das früher regelmäßig getan haben. Bei der frühzeitigen Identifikation können auch Datenanalysen im rechtlich zulässigen Rahmen und Feedbacksysteme helfen. Allgemein lässt sich sagen: Wenn sich das Verhalten ändert, sollte man aufmerksam werden. Wichtig ist dann eine gezielte, wertschätzende Ansprache mit echtem Mehrwert. Rückgewinnung funktioniert nicht über Rabatte, sondern über Beziehung. Wer merkt, dass die Bank sich ehrlich für ihn interessiert, bleibt eher – oder kommt zurück.
„Die Zukunft gehört den Banken, die Nähe, Vertrauen und digitale Kompetenz erfolgreich miteinander verbinden.“
Marcel Dulgeridis, Leiter Rechnungswesen bei der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann
Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrer Studie und welche Botschaft leiten Sie daraus für die Genossenschaftsbanken ab?
Dulgeridis: Genossenschaftsbanken verfügen über starke Bindungspotenziale, doch diese müssen bewusst aktiviert werden. Die Zukunft gehört denen, die Nähe, Vertrauen und digitale Kompetenz erfolgreich miteinander verbinden. Kundenbindung entsteht genau dort, wo Technologie und Menschlichkeit Hand in Hand gehen. Dabei ist es entscheidend, Kundinnen und Kunden wirklich zu verstehen – statt sie nur zu verwalten. In Zeiten von FinTechs bleibt so die Relevanz erhalten.
Perst: Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Preissensitivität der Kundinnen und Kunden, die oft das Zünglein an der Waage sein kann. Deshalb ist es essenziell, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, statt nur produktzentriert zu denken. Dazu gehört auch, Kundinnen und Kunden aktiv einzubinden und ihre Bedürfnisse kontinuierlich zu berücksichtigen. Zudem sollten Daten im rechtlich zulässigen Rahmen aktiv genutzt werden, um Modelle und Angebote flexibel anzupassen und so den individuellen Erwartungen besser gerecht zu werden.
Herr Dulgeridis, Herr Perst, vielen Dank für das Interview!

Dr. Florian Perst ist Dozent an der IU Internationalen Hochschule im Fachbereich Business & Management mit den Schwerpunkten Marketing und Prozessmanagement. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der digitalen Customer Journeys, wobei er Schlüsselfaktoren der Kundeninteraktion und -bindung entlang digitaler Journeys untersucht.

Prof. Dr. Marcel Dulgeridis ist Professor für Betriebswirtschaftslehre der IU Internationalen Hochschule am Standort Regensburg. Nach knapp zehn Jahren bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – zuletzt als Senior Manager – ist er mittlerweile Leiter Rechnungswesen bei der Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann.