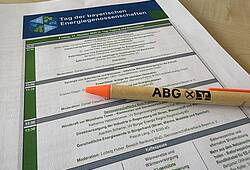Pilotprojekt: Wie die Bürgerenergiegenossenschaft BERR eG einen Tunnel zum Leuchten bringt.
Der Deutsche Bundestag hat am 13. November 2025 mit dem „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Energiebereich sowie zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften“ eine umfassende Gesetzesänderung im Energiewirtschaftsrecht beschlossen. Der Bundesrat erhob in seiner Sitzung am 21. November 2025 keine Einwände. Damit tritt das Gesetz in Kraft, sobald es vom Bundespräsidenten unterschrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.
Ziel ist es, europäische Vorgaben umzusetzen, den Ausbau erneuerbarer Energien (EE) voranzutreiben und die Digitalisierung der Energiewende zu stärken. Für Energiegenossenschaften, die EE-Projekte realisieren und Stromnetze betreiben, ergeben sich insbesondere in den Bereichen Energy Sharing, Netzbetrieb und Netzanschluss wichtige Neuerungen. Die Änderungen betreffen unter anderem das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die wichtigsten Punkte im Überblick:
Energy Sharing: Neue Möglichkeiten für EE-Projekte
Die Gesetzesnovelle fügt in § 42c EnWG-E neue Regelungen zum sogenannten „Energy Sharing“ ein. Diese ermöglichen Letztverbrauchern (natürliche und juristische Personen mit Ausnahme größerer Unternehmen) die gemeinsame Nutzung von Strom aus EE-Anlagen auch über das öffentliche Netz. Die Regelungen sehen im Einzelnen vor:
- Voraussetzungen und Beteiligung: Energy Sharing ist möglich, wenn der Strom aus einer EE-Anlage oder einer Energiespeicheranlage, in der ausschließlich EE-Strom zwischengespeichert wird, gemeinschaftlich genutzt wird (§ 42c Absatz 1 EnWG-E).
- Klarstellung zur Betreibereignung bei juristischen Personen: EE-Anlagen, die von juristischen Personen (also auch Energiegenossenschaften) betrieben werden, sind nur dann für das Energy Sharing geeignet, wenn der Betrieb weder überwiegend der gewerblichen noch überwiegend der selbstständigen beruflichen Tätigkeit aller Mitglieder oder beteiligten Gesellschafter (§ 42c Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 EnWG) dient. Die Regelungen ermöglichen Energy Sharing also für Zusammenschlüsse von Letztverbrauchern (wie Energiegenossenschaften), die sich ausschließlich zum Zweck der gemeinsamen Energienutzung gründen, indem diese auf die Tätigkeit aller Mitglieder und Gesellschafter und nicht auf die rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person des Privatrechts selbst abgestellt werden. Ferner darf eine juristische Person die EE-Energy-Sharing-Anlage auch betreiben, wenn für sie selbst der Betrieb keine überwiegende gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit darstellt.
- Netzbetreiberpflichten und Zeitplan: Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, die gemeinsame Nutzung sicherzustellen (§ 42c Absatz 4 EnWG-E), und zwar ab dem 1. Juni 2026 innerhalb des Bilanzierungsgebietes eines Elektrizitätsverteilernetzbetreibers sowie ab dem 1. Juni 2028 auch innerhalb des Bilanzierungsgebietes eines direkt angrenzenden Elektrizitätsverteilernetzbetreibers in derselben Regelzone.
- Vereinfachung der Direktvermarktung: Im Rahmen der gemeinsamen Nutzung von Strom aus EE-Anlagen wird der Grundsatz der „starren Proportionalität“ gelockert, was eine flexiblere Aufteilung von Strommengen zwischen verschiedenen Veräußerungsformen ermöglicht. Dies betrifft Regelungen in § 21b Absatz 2 EEG-E.
Webseminar zur EnWG-Novelle am 17. Dezember 2025
Das novellierte Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) enthält erstmalig Regelungen zum Energy Sharing. Der entsprechende neue Paragraf 42c EnWG ermöglicht es zukünftig, den Strom aus PV-, Windenergie- und anderen Erneuerbare-Energien-Anlagen gemeinsam über das öffentliche Netz zu nutzen oder zu verkaufen. In einem kostenfreien Webinar informiert die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV am Mittwoch, 17. Dezember 2025, von 17 bis 18.30 Uhr über die neuen Regelungen zum Energy Sharing und andere Neuerungen wie die Übergangsregelung zur Kundenanlage. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Referenten sind René Groß, Anton Mohr und Jonas von Obernitz von der Bundesgeschäftsstelle sowie Nico Storz von der Bürgerwerke eG. Das Webseminar richtet sich exklusiv an Energiegenossenschaften sowie energieinteressierte Genossenschaften und Banken, die Mitglied im GVB oder einem anderen genossenschaftlichen Regionalverband sind. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.
Netzausbau und Digitalisierung im Verteilernetz
Für Energiegenossenschaften, die Stromnetze betreiben, enthält das Gesetz wichtige Anpassungen und Verpflichtungen zur Digitalisierung und Beschleunigung:
- Überragendes öffentliches Interesse: Die Errichtung und der Betrieb von Elektrizitätsverteilernetzen liegen nun im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit (§ 14d Absatz 10 EnWG-E). Der beschleunigte Ausbau soll als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägung eingebracht werden, bis die Stromversorgung nahezu treibhausgasneutral ist. Ebenso liegen die Errichtung und der Betrieb von Energiespeicheranlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Der beschleunigte Ausbau von Energiespeicheranlagen soll bis zur Erreichung der nahezu treibhausgasneutralen Stromversorgung (2045) als vorrangiger Belang in die Schutzgüterabwägung eingebracht werden (§ 11c EnWG-E).
- Gemeinsame Internetplattform für den Netzzugang: Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen werden verpflichtet, eine gemeinsame und bundesweit einheitliche Internetplattform zu errichten und zu betreiben, um Verfahren im Bereich des Netzzugangs abzuwickeln (§ 20b EnWG-E).
- Veröffentlichung von Netzdaten: Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen müssen aggregierte Daten über Netzverlust-Energiemengen und Beschaffungskosten veröffentlichen (§ 23c Absatz 3 EnWG-E).
Eigenverbrauchsschutz bei Redispatch
Um den europarechtlich geschützten Eigenverbrauch von EE- und KWK-Strom (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung) bei Redispatch-Maßnahmen zu gewährleisten, muss der Netzbetreiber Artikel 13 Absatz 6 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/943 beachten, der im nationalen Recht in § 13a EnWG-E verankert ist.
Redispatch kurz erklärt
Die Bundesnetzagentur erklärt Redispatch wie folgt: „Unter Redispatch versteht man Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlastung zu schützen. Droht an einer bestimmten Stelle im Netz ein Engpass, werden Kraftwerke diesseits des Engpasses angewiesen, ihre Einspeisung zu drosseln, während Anlagen jenseits des Engpasses ihre Einspeiseleistung erhöhen müssen. Auf diese Weise wird ein Lastfluss erzeugt, der dem Engpass entgegenwirkt.“
Netzentgeltbefreiung für Speicher (Übergangsregel)
Die Anpassung in § 118 Absatz 6 Satz 3 EnWG-E stellt sicher, dass die Befreiung von Netzentgelten für Stromspeicher auch dann gewährt wird, wenn der ausgespeicherte Strom nur anteilig in dasselbe Netz wiedereingespeist wird, aus dem er entnommen wurde. Dies ermöglicht Betreibern die anteilige wirtschaftliche Vermarktung, da sie für diese Strommengen von der Netzentgeltbefreiung Gebrauch machen können. Durch den eingefügten Verweis auf § 21 des Energiefinanzierungsgesetzes (§ 21 EnFG-E) werden explizit auch bidirektional genutzte Ladepunkte für Elektromobile in diese anteilige Netzentgeltbefreiung einbezogen.
Marktteilnehmer und Verbraucherschutz
Es soll eine Pflicht zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Stromlieferanten eingeführt werden. Jeder Stromlieferant, der Haushaltskunden mit Elektrizität beliefert, muss zur Gewährleistung seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessene Absicherungsstrategien entwickeln und befolgen (§ 5 Absatz 4a EnWG-E). Diese Strategien sollen das Risiko von Änderungen des Elektrizitätsangebots auf dem Großhandelsmarkt für die wirtschaftliche Tragfähigkeit ihrer Verträge mit Kunden begrenzen. Zudem müssen Lieferanten angemessene Maßnahmen ergreifen, um das Risiko eines Ausfalls der Belieferung ihrer Kunden zu begrenzen.
Übergangsregelung für Kundenanlagen (bis 2029)
Die Neufassung von § 118 Absatz 7 EnWG-E schafft eine Übergangsregelung für Bestandskundenanlagen, die unter die bisherigen Kundenanlagenbegriffe des § 3 Nummer 65 und 66 fielen und bis zum Inkrafttreten des Gesetzes an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen wurden. Das heißt, alle Kundenanlagen, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes an ein Energieversorgungsnetz angeschlossen werden, können von der Übergangsregelung Gebrauch machen. Für diese Anlagen sind Vorgaben in Bezug auf die Regulierung von Energieversorgungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer 37 EnWG-E erst ab dem 1. Januar 2029 anzuwenden. Diese Übergangsregelung konserviert die bisherige Rechtslage für diese Bestandsanlagen für drei Jahre, um Betreibern (die möglicherweise komplexe interne Netze verwalten) Zeit zu geben, sich auf neue regulatorische Anforderungen einzustellen oder notwendige strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Ferner geben diese drei Jahre allen Beteiligten die Möglichkeit, weitergehende sowie dauerhafte fachliche, politische und gesetzgeberische Lösungen für Bestandskundenanlagen und neue Kundenanlagenprojekte zu entwickeln und umzusetzen.
Kundenanlage kurz erklärt
Eine Kundenanlage ist eine vom allgemeinen Versorgungsnetz abgegrenzte Energieerzeugungsanlage, die Letztverbraucher mit Energie versorgt. Sie kann aber an örtliche Verteilernetze angeschlossen werden. Beispiele sind Mehrfamilienhäuser mit eigenen Erzeugungsanlagen und Stromvertrieb nach Mieterstrommodell, aber auch Unternehmen aus Industrie und Gewerbe mit eigenen Erzeugungsanlagen und Unterabnehmern auf dem Betriebsgelände. In der Regel handelt es sich um Hausanlagen innerhalb von Gebäuden oder Gebäudekomplexen. In Einzelfällen, zum Beispiel bei Photovoltaik, kann sich die Anlage auch außerhalb von Gebäuden befinden und über ein größeres Grundstück erstrecken. Als dem Energieversorgungsnetz nachgelagerte Anlagen sind Kundenanlagen weitgehend von den regulatorischen Pflichten eines Netzbetreibers befreit. Anlagen mit eigenem Verteilernetz zählen nicht als Kundenanlagen.
Außenbereichsprivilegierung im Baugesetzbuch
Zur Beschleunigung der Energiewende wurden neue Vorhaben in den Katalog der im Außenbereich privilegierten Bauvorhaben aufgenommen. Dies betrifft nun Anlagen
- die der untertägigen Speicherung von Wärme oder Wasserstoff dienen (§ 35 Absatz 1 Nummer 10 BauGB-E), und
- die der Speicherung von elektrischer Energie in einer Batteriespeicheranlage mit einer Speicherkapazität von mindestens 1 Megawattstunde dienen (§ 35 Absatz 1 Nummer 11 BauGB-E).
Fristverlängerung im Wärmeplanungsgesetz
Für bestehende Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind, verlängert sich die Frist zur Erstellung des Wärmeplans bis zum 31. Dezember 2026, sofern die Erstellung Gegenstand einer Förderung aus Mitteln des Bundes war (§ 5 Absatz 2 Satz 1 WPG-E).
Ausblick
Die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV hat sich gemeinsam mit den genossenschaftlichen Regionalverbänden über viele Jahre für die Einführung von Energy Sharing erst auf europäischer und anschließend auf nationaler Ebene in der Politik eingesetzt. Die mit der genossenschaftlichen Praxis entwickelte Idee war die Schaffung einer Möglichkeit, dass EE-Strom aus gemeinsamen Erzeugungsanlagen zusammen wirtschaftlich genutzt beziehungsweise geliefert werden kann.
Politisch ließ sich ein solches wirtschaftliches Energy Sharing nicht durchsetzen. Durch den deutschen Gesetzgeber wird nun eher ein Energy Sharing für natürliche Personen (Letztverbraucher) eingeführt. Es bleibt aber positiv festzuhalten, dass sich nun erstmalig Regelungen zum Energy Sharing in deutschen Energiegesetzen wiederfinden. Das ist angesichts der bisherigen Situation als ein großer Erfolg anzusehen. Die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV sieht diese Regelungen als einen Ausgangspunkt, den es in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln gilt. Sie wird sich weiter dafür einsetzen, dass die Energy-Sharing-Regelungen für die genossenschaftliche Praxis verbessert werden. Außerdem begrüßt die Bundesgeschäftsstelle den Aufbau einer zentralen Netzzugangsplattform und die Verbesserungen für Speicher (wie die Außenbereichsprivilegierung, Netzentgeltbefreiung).
Mit der dreijährigen Übergangsregelung für Bestandskundenanlagen reagiert der Gesetzgeber sehr erfreulich auf die Probleme, die das Urteil des Bundesgerichtshofs geschaffen hat. Hierzu hat die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften unter anderem im August 2025 gemeinsam mit 26 weiteren Stakeholdern aus Mittelstand, der kommunalen Energiewirtschaft und der Immobilienwirtschaft einen Appell an die Bundesregierung gerichtet. Die Bundesgeschäftsstelle wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, eine dauerhafte und zufriedenstellende Lösung für bestehende und neue Kundenanlagenprojekte zu finden.
René Groß ist Leiter Strategie und Politik der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV).
Bundeskongress genossenschaftliche Energiewende 2026
Die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV lädt für Dienstag, 27. Januar 2026, zum Bundeskongress genossenschaftliche Energiewende 2026 ins Haus der DZ BANK am Brandenburger Tor in Berlin (Pariser Platz 3) ein. Beginn ist 10 Uhr (Einlass ab 9.30 Uhr), der Eintritt ist frei. In den Impulsvorträgen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die energiepolitischen Herausforderungen der neuen Legislatur. Es folgen ein Wärmepanel und ein energiepolitisches Podium. Außerdem gibt es wieder eine Innovationsschau mit Energiewendeprojekten aus der genossenschaftlichen Gruppe. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, die beste Idee mit dem Publikumspreis auszuzeichnen. In den Pausen, im Anschluss an den Bundeskongress sowie beim Jahresempfang der deutschen Genossenschaften bietet sich ausreichend Gelegenheiten zum Vernetzen und Austauschen. Hier gibt es das ausführliche Programm.
Zur Anmeldung für den kostenlosen Kongress hier entlang: dgrv-service.de/kongress
Und hier geht es zur Anmeldung für den abendlichen Festempfang: dgrv-service.de/jahresempfang