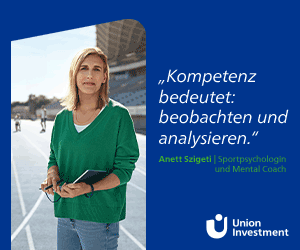Balance: Wer viel leisten will, muss sich gut erholen können. Die Kunst ist, einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeit und Ruhezeit zu finden: die Work-Life-Balance.
Anzeige
Anzeige
Frau Professorin Niessen, der Stresspegel am Arbeitsplatz steigt, wie jüngst zum Beispiel der Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in einer Studie dargelegt hat. Wie ist Ihre Wahrnehmung dazu?
Cornelia Niessen: Die Erkenntnisse kann ich bestätigen. Viele Unternehmen berichten schon seit Jahren von einer höheren Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Stress am Arbeitsplatz. Bei einer Befragung für den Stressreport Deutschland 2019 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin haben 48 Prozent der Studienteilnehmer über hohen Termin- und Leistungsdruck geklagt – und das war vor der Corona-Pandemie.

Cornelia Niessen ist Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Psychologie im Arbeitsleben am Institut für Psychologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Foto: privat
Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück?
Niessen: Die Arbeitsintensität hat zugenommen. Mitarbeitende müssen in der verfügbaren Zeit immer mehr Aufgaben in einer hohen Qualität erledigen. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass aufgrund dieses Zeit- und Termindrucks Fehler passieren oder Ziele nicht erreicht werden. Dazu kommen die digitalen Kommunikationskanäle, die für ein stetig hohes Informationsaufkommen sorgen. Diese Informationsflut müssen die Beschäftigten erstmal verarbeiten. Das führt zu zusätzlichem Zeitdruck und letztlich zur Überforderung. Das stellt auch die Arbeitszeitbefragung 2021 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin fest.
Digitale Prozesse können Mitarbeitende aber auch entlasten …
Niessen: Das ist auf der einen Seite richtig. Durch digitale Prozesse lassen sich viele Dinge effizienter erledigen. Ein uraltes Beispiel ist die E-Mail, die den Brief ersetzt hat und dadurch Zeit spart. Auf der anderen Seite sorgt die Digitalisierung dafür, dass unsere Arbeit immer schnelllebiger wird und die Erwartungshaltung steigt. Denken Sie nur an KI-Chatbots wie ChatGPT. Wer nimmt sich noch Zeit für ein wohlformuliertes Anschreiben, wenn das doch mit ChatGPT viel schneller geht? Durch die immer schnelleren Innovationszyklen wird die Arbeit zudem sehr komplex, weil man sich in jede neue Anwendung erst einarbeiten muss. Auch das belastet die Mitarbeitenden. Diese Folgekosten der Digitalisierung werden häufig unterschätzt. Noch ein Wort zur Informationsflut …
„Je flexibler und je selbstbestimmter wir arbeiten, desto mehr Selbstregulation müssen wir aufbringen.“
Schießen Sie los …
Niessen: Die Informationsflut ist ein sehr großer Stressfaktor – im Fachjargon Stressor – in der Arbeitswelt. Es ist ja nicht nur so, dass man Informationen immer schneller aufnehmen und verarbeiten muss, sondern man muss auch immer schneller relevante von irrelevanten Informationen unterscheiden. Das erfordert sehr viel Selbstregulation. Damit ist in der Psychologie die Fähigkeit von Menschen gemeint, ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlungen zu steuern. Je flexibler und je selbstbestimmter wir arbeiten, desto mehr Selbstregulation müssen wir aufbringen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir durch ständige Meetings, Mails und Chatnachrichten immer öfter in unserer Arbeit und unserer Konzentration gestört werden.
„Den Fokus zu halten und Impulse zu kontrollieren, erfordert Konzentration. Das kostet viel Energie und kann über den Tag sehr erschöpfen.“
Oder man schaut ständig auf das eigene Smartphone, ob es dort etwas Neues gibt …
Niessen: Ganz genau. Den Fokus zu halten, Störungen auszublenden und Impulse zu kontrollieren, erfordert Konzentration. Das kostet viel Energie und kann über den Tag sehr erschöpfen. Wenn sich das über Tage und Wochen kumuliert, kann das auch zu längeren Erschöpfungsphasen führen.
Sie haben den hohen Leistungsdruck in Unternehmen erwähnt. Woher kommt dieser?
Niessen: Die hohe Arbeitsbelastung ist ein Problem. Der Fachkräftemangel führt mittlerweile dazu, dass Personen nicht ersetzt werden und die Arbeit auf andere aufgeteilt wird. Um dieses Pensum zu bewältigen, müssen die Betroffenen entweder schneller oder länger arbeiten. Wollen sie schneller sein, versuchen sie etwa, alles gleichzeitig zu erledigen. Sie beantworten in Sitzungen E-Mails oder recherchieren parallel zu einem Telefongespräch im Internet, und am Ende wundern sie sich, warum sie nach einem Zoom-Meeting müde sind. Ja warum? Weil sie Doppel- und Dreifachaufgaben erledigt haben, dabei aber nicht sonderlich effektiv waren. Manche nehmen dann einfach Arbeit mit nach Hause. Dadurch entsteht jedoch neuer Stress, da aufgrund der beruflichen Verpflichtungen die Anforderungen aus dem Privatleben nicht mehr ausreichend erfüllt werden können. Das führt außerdem oft dazu, dass die Arbeitszeiten in Summe ausgedehnt werden. In der Wissenschaft sprechen wir von einem Dreiklang aus übergeordneten Stressoren: Arbeitsverdichtung, Digitalisierung und Entgrenzung der Arbeit.
Welche Stressoren gibt es noch im Arbeitsleben?
Niessen: Ein Stressor ist der sogenannte Rollenstress beziehungsweise die Rollenambiguität. Gemeint ist damit, dass ich in der Arbeit eine Rolle oder eine Aufgabe übernehmen muss, von der ich nicht weiß, wie ich sie ausführen soll. Das stresst mich und führt zu Überlastung. Hinzu kommen soziale Stressoren wie Konflikte im Team und mit Vorgesetzten, aber auch generell ein schlechtes Arbeitsklima. Ebenfalls für viel Stress sorgt der Work-Nonwork- oder Work-Family-Conflict, wenn Spannungen in Beruf oder Privatleben jeweils in den anderen Bereich hineinstrahlen und die Menschen das nicht mehr ausgleichen können. Diese Doppelbelastungen absorbieren sehr viele Kräfte.
Ist die Vermischung von privaten und beruflichen Angelegenheiten generell ein Stressor für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Niessen: So pauschal würde ich das nicht sagen. Es kommt ganz auf die dadurch entstehende Belastung und die Präferenzen der einzelnen Person an. Es gibt manche, die separieren Arbeit und Privatleben komplett. Wenn die zuhause den Schlüsselbund aus der Hand legen, wollen sie mit der Arbeit nichts mehr zu tun haben. Dann gibt es andere, die wären sehr irritiert, wenn sie nach 17 Uhr keine E-Mail mehr beantworten dürften, weil sie vielleicht vom Biorhythmus her am Abend besonders kreativ sind. Dafür finden sie es vielleicht gut, wenn sie ihr Kind zwischendurch mal zum Sport fahren können oder einen privaten Anruf erledigen. Da muss jeder schauen, was individuell zu ihm passt, sofern das die Arbeit zulässt und sofern das Arbeitsrecht und das Arbeitszeitgesetz eingehalten werden. Eigentlich ist es nichts Schlimmes, wenn man mit der Arbeit auf Tagesrandzeiten ausweicht. Die Frage ist nur, ob man dann noch genügend Zeit hat, sich zu erholen und einen Ausgleich zur Arbeit zu finden, zum Beispiel mit Sport. Regelmäßige Erholung ist absolut wichtig.

Workout mit Rennrad: Sport ist eine gute Möglichkeit, um einen Ausgleich zur Arbeit zu finden. Foto: mauritius images / Westend61 / Stefan Schurr
Wie wirken externe Faktoren wie zum Beispiel die wenig erbauliche Wirtschaftslage auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Niessen: Die allgemeine Wirtschaftslage spielt sicher eine Rolle, konkret ist hier besonders die damit verbundene Arbeitsplatzunsicherheit zu nennen. In manchen Branchen wird diskutiert, dass Arbeitsplätze irgendwann durch Roboter oder Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Die Zukunftsszenarien, die in dieser Hinsicht gezeichnet werden, sind teilweise düster. Zum Beispiel werden Übersetzungen für Gebrauchsanweisungen immer weniger nachgefragt. Das erledigt die KI vielleicht nicht besser, aber effizienter. Viele Menschen haben deshalb Angst davor, dass früher oder später zumindest Teile ihrer Arbeit wegfallen oder sogar der ganze Job. Arbeitsplatzunsicherheit – also die gedankliche Antizipation von Arbeitslosigkeit – wirkt sich fast so negativ auf das persönliche Wohlbefinden und die psychische Gesundheit aus wie die Arbeitslosigkeit selbst. Das löst in der Regel starke Emotionen und Gefühle bis hin zur Existenzangst aus. Die einen arbeiten dann besonders viel, um beim Arbeitgeber gut dazustehen, die anderen ziehen sich eher zurück – sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Beides ist ein Problem. Angst ist einfach ein schlechter Ratgeber im Job. Die Kreativität und die Problemlösungskompetenz sinken, zudem brauchen solche Menschen länger, um sich an Veränderungen anzupassen.
„Stress ist bei weitem nicht so harmlos, wie er im Alltag behandelt wird. Wenn Menschen längerfristig großem Stress ausgesetzt sind, kann das schwere gesundheitliche Folgen haben.“
Sie haben die gesundheitlichen Folgen von Stress am Arbeitsplatz bereits angerissen. Wie reagiert der Körper auf solche Situationen?
Niessen: Die Folgen können ganz vielfältig sein, es gibt kurzfristige und langfristige. Kurzfristig löst Stress negative Emotionen aus, der Körper reagiert mit einer erhöhten Herzrate und der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Das persönliche Wohlbefinden ist beeinträchtigt. Bei chronischem Stress steigt die Wahrscheinlichkeit, eine Depression oder depressive Symptome zu entwickeln, zudem belegen eine Reihe von Studien, das Stress zu Herzkreislauferkrankungen und zu einer erhöhten Mortalität führen kann. Um es kurz zu machen: Stress ist bei weitem nicht so harmlos, wie er im Alltag oft behandelt wird. Wenn Menschen längerfristig großem Stress ausgesetzt sind, kann das schwere gesundheitliche Folgen haben.

Herzuntersuchung in einem Krankenhaus: Stress kann zu Herzkreislauferkrankungen und im schlimmsten Fall zu einer erhöhten Mortalität führen. Foto: mauritius images / Elizaveta Tomashevska / imageBROKER
Wie reagieren die Menschen auf Stress am Arbeitsplatz?
Niessen: Stress führt zu einer negativeren Arbeitseinstellung, die Menschen sind in ihrem Job weniger zufrieden. Dann reagieren sie auch mit ihrem Verhalten. Sie sind gereizt, kommen zu spät oder verhalten sich passiv, weil sie innerlich gekündigt haben. Chronischer Stress kann auch zu längerfristigen Krankschreibungen führen. Einige der betroffenen Personen vernachlässigen zudem ihre sozialen Beziehungen im Job. Sie ziehen sich aus ihrem Team heraus, weil ihnen alles zu viel wird. Wer als Chef solches Verhalten beobachtet, sollte im Gespräch mit den Betroffenen ausloten, was die Ursachen für den sozialen Rückzug sind, um ihnen, falls möglich, entgegenzuwirken.
„Wenn das Betriebsklima schlecht ist, haben viele Mitarbeitende keine Lust mehr, im Job Verhaltensweisen zu zeigen, die besonders wertvoll für die Organisation sind.“
Welche Folgen hat das für die Arbeitsorganisation und die Produktivität von Unternehmen?
Niessen: Die Arbeitsorganisation und die Produktivität leiden auf vielen Ebenen. Das kann sich schnell aufschaukeln. Lassen sich gestresste Kolleginnen und Kollegen krankschreiben, müssen die anderen die Arbeit auffangen. Wenn die Belastung zu hoch wird, lassen sie sich ebenfalls krankschreiben, und auf einmal leidet das Unternehmen unter Personalmangel und kann möglicherweise Aufträge nicht mehr fristgerecht erledigen. Wahrscheinlich passieren auch Fehler. Ist im Team generell viel Druck auf dem Kessel, leidet das Arbeitsklima, weil etwa die Zeit fehlt, etwas in Ruhe zu besprechen oder Prozesse nicht mehr reibungslos laufen. Das kann zu Konflikten im Team führen. Häufig geht es um Gerechtigkeitsfragen, weil jemand auf einmal weniger arbeitet und die anderen das auffangen müssen. Das sind aber nur die direkten Folgen.
Und die indirekten?
Niessen: Wenn das Betriebsklima schlecht ist, haben viele Mitarbeitende keine Lust mehr, im Job Verhaltensweisen zu zeigen, die besonders wertvoll für die Organisation sind. Motivierte Mitarbeitende erledigen nicht nur ihre unmittelbaren Aufgaben gut, sondern sie bringen sich darüber hinaus proaktiv ein, indem sie zum Beispiel dabei helfen, Probleme zu lösen oder Prozesse zu verbessern. Sie äußern konstruktive Kritik und engagieren sich häufig über das Normale hinaus für ein gutes Betriebsklima – lauter positive Effekte, die sich gegenseitig verstärken. Viele Studien zeigen, dass solche positiven Verhaltensweisen der Mitarbeitenden tatsächlich zu einer besseren Produktivität führen. All das fällt bei einem schlechten Betriebsklima weg.
Wie können Führungskräfte dazu beitragen, eine durch Stress am Arbeitsplatz ausgelöste negative Abwärtsspirale zu vermeiden?
Niessen: Das Wichtigste ist eine vernünftige Ursachenanalyse. Es wäre nicht zielführend, die Probleme im Team von vorneherein zu individualisieren und die Schuld bei einzelnen Personen zu suchen. Stattdessen sollte der Mikrokosmos im Team nüchtern analysiert werden, am besten gemeinsam mit den Mitarbeitenden. Wer hat Zeitdruck, wo fehlen Ressourcen, wo fehlen Informationen, und so weiter. Auf Unternehmensebene gibt es dazu die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, die als Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements gesetzlich vorgeschrieben ist und von den Krankenkassen bezuschusst wird. Im Kleinen können die Führungskräfte gemeinsam mit den Mitarbeitenden nach Belastungen und Lösungsmöglichkeiten suchen und diese umsetzen.
„Führungskräfte, die gut führen und eine positive Beziehung zu ihren Mitarbeitenden aufbauen, haben einen positiven Einfluss auf deren Gesundheit.“
Reicht das? Wenn es Ursachen für Stress zu analysieren gibt, ist dieser doch schon vorhanden.
Niessen: Das Beste ist natürlich immer, wenn dysfunktionaler Stress gar nicht erst entsteht. Führungskräfte, die gut führen und eine positive Beziehung zu ihren Mitarbeitenden aufbauen, haben einen positiven Einfluss auf deren Gesundheit. Das zeigt die Forschung eindeutig. Oft reichen kleine Maßnahmen: Einfach mal nachzufragen, wie es dem Kollegen oder der Kollegin gerade geht, angemessene und realistische Ziele setzen, ein aufgabenbezogenes Feedback geben, solche Dinge. Wichtig ist auch, dass Chefinnen und Chefs die persönlichen Kompetenzen und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden richtig einschätzen und ihnen passende Aufgaben in der richtigen Menge zuweisen. Außerdem motiviert es ungemein, wenn Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden die Bedeutsamkeit ihrer Arbeit glaubhaft vermitteln. Das zahlt alles auf das positive Wohlbefinden und damit auf die Gesundheit der Mitarbeitenden ein. Führungskräfte sind zudem Vorbilder. Wenn sie selbst einen gesundheitsförderlichen Lebensstil pflegen, überträgt sich das auf die Mitarbeitenden. Diese sehen dann, es ist ok, das Kind auch mal zwischendurch vom Kindergarten abzuholen oder mittags eine Runde zum Laufen zu gehen. Mitarbeitende achten darauf, welchen Lebensstil die Führungskraft vorlebt und wie sie sich im Job verhält. Deshalb sollten Chefs auch auf ihre eigenen Stressreaktionen achten und diese kontrollieren. Stress kann sich schnell auf das Team übertragen.

Obstkorb am Arbeitsplatz: Der Verzehr von Obst und Gemüse beugt Krankheiten vor. Unternehmen sollten jedoch darauf achten, über diese Maßnahmen hinauszugehen und die Verantwortung für das Stressmanagement nicht allein den einzelnen Mitarbeitenden zu überlassen. Foto: mauritius images / Westend61 / WB-Images
Wie können Unternehmen auf organisatorischer Ebene dafür sorgen, Stress bei ihren Mitarbeitenden zu vermeiden?
Niessen: Hier gibt es vielfältige Angebote auf dem Markt, von Gesundheitstagen über Achtsamkeits-Apps bis zu Trainings zum Stressmanagement. Das ist alles hilfreich und zielführend. Auch gegen den Obstkorb in der Teeküche ist nichts einzuwenden – ein gesunder Lebensstil beugt Krankheiten vor. Unternehmen sollten jedoch darauf achten, über diese Maßnahmen hinauszugehen und die Verantwortung für das Stressmanagement nicht allein den einzelnen Mitarbeitenden zu überlassen. Es gibt genügend Studien, die belegen, dass die Arbeitsbedingungen für die Stressreaktionen ausschlaggebend sind. Hier muss die Prävention der Unternehmen ansetzen. Dazu gehört darüber hinaus auch eine gute Führungskultur, die Mitarbeitende wertschätzt und im Rahmen des Möglichen auf deren Bedürfnisse und Fähigkeiten eingeht. Viele weitere Ursachen für Stress am Arbeitsplatz, die vermieden werden sollten, habe ich bereits genannt.
Trotzdem gibt es Situationen, in denen Stress nicht zu vermeiden ist, selbst in funktionierenden Teams. Wie können sich Mitarbeitende selbst vor solchen Situationen schützen?
Niessen: Im Grunde sind das ähnliche Tipps wie für Führungskräfte, die ihr Team vor Stress schützen wollen. Man kann sich selbst beobachten und analysieren, warum man in Stress geraten ist und welche Dynamiken das ausgelöst hat. Wenn man das für sich oder im Gespräch mit einer Vertrauensperson geklärt hat, kann man überlegen, wie man sich das nächste Mal besser verhält oder wer einem helfen kann. Hilfreich ist auch, die eigenen Ressourcen zu analysieren, zum Beispiel indem man einen Kurs für Stressmanagement besucht. Ebenso kann es helfen, dysfunktionale Gedanken – „Wenn ich das nicht schaffe, mögen mich die Kollegen nicht“ – zu hinterfragen und dafür Bewältigungsmechanismen zu lernen. Mindfulness-Trainings sind ebenfalls ein Tipp, selbst kurze Interventionen bringen etwas, wenn man dafür aufgeschlossen ist. Es gibt aber noch einen weiteren Ansatzpunkt: Job Crafting.
„Mitarbeitende können für sich selbst einmal ausloten, welche Spielräume sie haben, um ihren eigenen Arbeitsplatz nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten.“
Was versteht man unter Job Crafting?
Niessen: Normalerweise geht man davon aus, dass Organisationen und Führungskräfte die Arbeitsbedingungen mehr oder weniger festlegen. Allerdings haben die Mitarbeitenden unter Umständen durchaus Möglichkeiten, Spielräume zu nutzen und ihren eigenen Arbeitsplatz nach individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Sie können zum Beispiel je nach Neigung manche Aufgaben mit mehr Hingabe und andere etwas stiefmütterlicher ausführen. Sie können schauen, welche Aufgabe sie gegebenenfalls mit Kolleginnen und Kollegen tauschen können, mit wem sie enger zusammenarbeiten möchten und welche Ressourcen sie noch benötigen. Hilfreich ist auch, der eigenen Arbeit eine sinnstiftende Bedeutung zuzumessen. Ein Beispiel: Ein Controller kontrolliert Zahlen, oder er trägt mit seiner Arbeit dazu bei, das Unternehmen zukunftsfähig zu erhalten. Die gleiche Arbeit, zwei unterschiedliche Haltungen dazu. Bei Job Crafting geht es also darum, die Arbeit an seine eigenen Stärken, Bedürfnisse und Leidenschaften anzupassen. Am besten ist es, das einfach auszuprobieren und mit kleinen Dingen im Arbeitsalltag anzufangen. Denn auch hier zeigen kleine Veränderungen manchmal eine große Wirkung, auch für das Wohlbefinden und das persönliche Wachstum.
Sommerzeit ist Ferienzeit. Wie können sich Menschen im Urlaub erholen, ohne sich von der Arbeit stressen zu lassen?
Niessen: Untersuchungen zeigen, dass sogenannte Mastery-Erlebnisse, die Kontrolle über die eigene Freizeit, Entspannung und vor allem das Abschalten von der Arbeit die Erholung ausmacht. Man erholt sich zum Beispiel bei Aktivitäten, bei denen Personen neue Fähigkeiten erproben oder Herausforderungen bewältigen – und dadurch ein Gefühl von Kontrolle, Kompetenz und persönlichem Wachstum erleben (Mastery). Wenn ich also einen Berg ersteige und das Gefühl habe, ich habe etwas geschafft. Oder einen Sprachkurs mache und hinterher eine Fremdsprache besser spreche. Oder tolle Fotos schieße. Das ist sehr erholsam. Ich kann zudem besser abschalten, wenn ich mich über eine längere Zeit in einen anderen Kontext begebe, also woanders hinfahre oder Personen treffe, die mir wichtig sind, die ich aber vielleicht sonst nicht so oft sehe. Auch ist die Kontrolle über meine eigene Freizeit wichtig. Nur ich kann bestimmen, was ich in meinem Urlaub mache und kein anderer. Entspannung ist natürlich auch erholsam. Das sind alles wichtige Ansatzpunkte, die Frage ist nur: Wie kommt man dahin?
Eine berechtigte Frage …
Niessen: Wichtig ist, dass man sich im Urlaub von der Arbeit distanziert und negative Dinge ausblendet. Sonst kann man nicht abschalten. Da ist es wenig hilfreich, wenn man die normale Arbeit mit in den Urlaub nimmt, die erledigt werden muss. Andererseits spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, sich im Urlaub mit fachlichen Fragen auseinanderzusetzen, wenn einem das Spaß macht. Wenn ich es im Urlaub endlich schaffe, den Fachartikel zu lesen, den ich schon immer lesen wollte, und ich für das Thema brenne, dann kann das auch ein besonderes Erlebnis sein. Täglich E-Mails zu beantworten, gehört sicher nicht dazu. Ich warne zudem vor übertriebenen Erwartungen an den Urlaub, vor allem in den ersten Tagen. Jetzt fahren wir mit der ganzen Familie in die Ferien und haben alle zusammen Spaß – solche Abziehbilder passen nur selten zur Realität. Jede Person bringt ihre eigenen Gedanken und Abläufe in den Urlaub mit; bis sich alle zusammenfinden, dauert das ein paar Tage. Am Anfang kommen vielleicht auch bestimmte Dinge hoch, die zu verarbeiten man bisher keine Zeit hatte. Dann rumpelt es manchmal. Deswegen ist man aber noch kein schlechter Urlauber. Die Kontrolle über die eigene Freizeit gilt selbstredend auch für die anderen Urlaubsteilnehmer, sonst ist der Familienstreit nicht weit.

Im Urlaub von der Arbeit abschalten: Das gelingt nur, wenn man die Kontrolle über die eigene Freizeit hat. Foto: mauritius images / Cavan Images
Zum Schluss eine etwas abstrakte Frage: Work-Life-Balance, Work-Life-Separation, Work-Life-Blending – es gibt viele Modelle für die Gestaltung von Beruf und Privatleben. Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach an?
Niessen: Zuerst einmal klingen alle diese Begriffe sehr normativ. Work-Life-Balance würde ja bedeuten, dass wir Arbeit und Leben jederzeit in Balance halten sollen und dass Arbeit und Leben sich gegenüberstehen, zwei verschiedene Bereiche sind. Es gibt Lebensphasen, wo man einfach mehr Energie in die Arbeit steckt und weniger auf sich und sein Privatleben achtet. Dann gibt es Phasen, wo es umgekehrt ist, etwa mit einer jungen Familie oder wenn man ein Haus baut. Dabei geht es auch immer um die längerfristige Perspektive. Dabei müssen wir uns fragen, wie gut es uns in der jeweiligen Phase geht. Wenn wir feststellen, dass unser Leben aus dem Gleichgewicht gerät – etwa, weil unsere gesamte Energie in den Beruf fließt, während sich Lebensumstände, Werte oder Prioritäten verändert haben –, ist das ein wichtiges Signal für Veränderung. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, bewusst Grenzen zu setzen oder bestehende Routinen neu zu gestalten. Hilfreich ist in solchen Fällen auch, seine eigenen Ressourcen zu kennen, um zu einer Lösung zu kommen. Wer unterstützt mich, wenn es mir schlecht geht? Wer passt auf meine Kinder auf, wenn ich arbeite? Aber auch: Habe ich genügend Geld beiseitegelegt, um mir einen anderen Job suchen zu können? Auch das kann manchmal eine Lösung sein.
Und ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage: Was tun Sie, um Stress in Ihrem Beruf als Wissenschaftlerin und Arbeitspsychologin zu reduzieren?
Niessen: Meinen Beruf komplett stressfrei zu gestalten, ist nicht möglich. Das möchte ich auch gar nicht. Ich muss mich aber ab und zu fragen, wie viele zusätzliche, durchaus auch positive Verpflichtungen und Aufgaben mein Arbeitsalltag verträgt. Ich besuche Konferenzen, gebe Workshops, halte Vorträge, bilde mich weiter, aber ich muss auch dafür sorgen, dass ich zwischendurch immer auch kleine Pausen habe, damit es nicht zu stressig wird. Denn ich habe nun mal im Alltag viel Zeit- und Termindruck. Mit zunehmendem Alter wird für mich Sport als Ausgleich immer wichtiger, das muss ich wirklich sagen. Und dann hilft es mir, etwas ganz anderes zu erleben, um über meine fachlichen Themen hinaus neue Blickwinkel einzunehmen. Ich besuche zum Beispiel gerne Kulturveranstaltungen. Das bringt mich auch emotional wieder in eine gute Balance und dann geht’s weiter – oft mit viel Freude und Energie.
Frau Professorin Niessen, vielen Dank für das Gespräch!